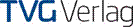*
*
*
*
*
grubmard
,
19.04.2024
golocal
„Der heutige Berliner Ortsteil Friedrichshagen liegt im Südosten der Stadt am Nordufer von Großem Müggelsee und Müggelspree.
König Friedrich II. v. P…reußen (1712-1786 / König ab 1740) wollte um 1750 seinem bevölkerungs- und strukturschwachem Königreich zu mehr Bewohnern und Gewerbe verhelfen und gründete damals zahlreiche Siedlungen mit Kolonisten aus anderen, nicht nur deutschen Landen.
Zu diesen Gründungen gehörte auch das am 29.5.1753 durch eine Order von Friedrich II. gegründete Lehnschulzengut und die Kolonistensiedlung Friedrichshagen. Die wenigen einfachen Häuser standen südlich des heutigen Marktplatzes und wurden mit schlesischen und böhmischen Baumwollspinnern besiedelt.
Bereits in der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts wohnte dort, wo die Spree aus dem Müggelsee ihren Weg Richtung Westen fortsetzt, ein Landjäger, der auch einen Ausschank betrieb.
Das königliche Lehnschulzengut befand sich auf dem heutigen Brauerei- und Bräustübl-Gelände. Gleichzeitig verlieh der König dem damaligen Lehnschulzen und Domänenrat Pfeiffer das Schankrecht. Pfeiffer, an den noch heute die Pfeiffergasse neben der Gaststätte „Bräustübl“ erinnert, errichtete ein erstes Brauhaus, aus der sich dann später die Friedrichshagener Brauerei entwickelte, die 2010 ihre Produktion stilllegen musste.
Eine Idee des Königs war, sich unabhängig von teuren chinesischen Seidenimporten zu machen. Deshalb ließ er in zahlreichen Orten 3 Millionen Maulbeerbäume zur Seidenraupenzucht anpflanzen. So auch in Friedrichshagen.
Die Siedler mussten sich auf königliche Weisung auch um die entlang der Hauptstraße gepflanzten chinesische Maulbeerbäume kümmern.
Allerdings mochten die Siedler die Bäume nicht und die Bäume und die Raupen mochten das hiesige Wetter nicht.
Das Seidenraupenzuchtprogramm scheiterte. Von den Maulbeerbäumen existiert nur noch der Weiße Maulbeerbaum vor der Bölschestraße 126 von der Nachpflanzung aus den 1850er Jahren. Allerdings wurden in den vergangenen Jahren zahlreiche Maulbeerbäume nachgepflanzt.
Jahrzehntelang führte Friedrichshagen ein beschauliches Dasein als Landgemeinde weit vor den Toren Berlins. Die Bewohner lebten mehr schlecht als recht von der Baumwollspinnerei und Besenbinderei.
Um 1800 wurde eine kleine Kirche gebaut, die erst 1848 einen Glockenturm erhielt.
1832 wurde der heute noch genutzte Friedhof eröffnet, denn der Kirchhof um die Kirche war überbelegt.
Der Aufschwung kam 1849 mit dem Bau der Eisenbahnstrecke von Berlin nach Frankfurt/O und Breslau (heute Wroclaw in Polen) durch die Niederschlesisch-Märkische Eisenbahn. Nördlich des Ortes wurde ein Haltepunkt eingerichtet, der später zum Bahnhof der Berliner Vorortbahn ausgebaut wurde (heute S-Bahnhof „Berlin-Friedrichshagen“).
Mit dem Eisenbahnanschluss entdeckten die Berliner das bis dahin unscheinbare Friedrichshagen als Ausflugsziel und als Villenvorort fürs Großbürgertum.
Das Erscheinungsbild änderte sich radikal. Zahlreiche Villen wurden erbaut, die auch heute noch existieren. Bevorzugt war natürlich das Nordufer des Müggelsees. Aber der Platz dort ist begrenzt und so wurde auch das Umland rund um die Hauptstraße, die bis 1945 nach dem Ortsgründer „Friedrichstraße“ hieß (heute Bölschestraße) zum begehrten Bauland.
1880 wurde Friedrichshagen der Titel „Luftkurort“ verliehen. Aus dieser Zeit existiert bis heute der Kurpark nördlich vom S-Bahnhof.
Handel, Gewerbe, Gastronomie und Hotels siedelten sich an. 1887 nahm die Gladbeck’sche Bildgießerei den Betrieb auf, in der in den nächsten 40 Jahren zahllose Denkmäler für das gesamte Reichsgebiet entstanden.
Das wachsende und sich industrialisierende Berlin hatte einen hohen Wasserbedarf. Neue Wasserwerke wurden benötigt. Das Wasserwerk Friedrichshagen wurde ab 1888 im neogotischen Klosterstil aus rotem Backstein erbaut. Bis heute ist es einer der wichtigsten Trinkwasserlieferanten für Berlin, auch wenn heute das Trinkwasser nicht aus dem Oberflächenwasser des Müggelsee’s sondern aus Tiefbrunnen gewonnen wird.
Die ruhige und immer noch von der umtriebigen Hauptstadt abgeschiedene Lage zog auch zahlreiche Künstler, Schriftsteller und Wissenschaftler nach Friedrichshagen, wo 1890 der „Friedrichshagener Dichterkreis“ um die Schriftsteller Wilhelm Bölsche (1861-1939) und Bruno Wille (1860-1928) gegründet wurde.
Zum Dichterkreis gehörten ua. August Strindberg (1849-1912), Frank Wedekind (1864-1918), Erich Mühsam (1878-1934), Bertha v. Suttner (1843-1914).
1895 wurde eine Fähre über die Spree eingerichtet, um Ausflüglern von Friedrichshagen aus den Besuch des 1880 erbauten Müggelturms zu erleichtern.
Zu Wohlstand gekommen und auf Kleinstadtgröße gewachsen, gönnte sich Friedrichshagen 1897 ein neues Rathaus und 1903 die neue große evangelische Christophorus-Kirche, die sich heute mit verändertem Aussehen präsentiert. 1972 zerstörte ein Orkan den Kirchturm, der erst Jahre später in stark vereinfachter Weise wiederaufgebaut wurde.
1904 wurde für den Ortsgründer König Friedrich II. ein Denkmal auf dem Marktplatz errichtet.
Das Denkmal ging 1945 in den Nachkriegswirren verloren und wurde vermutlich eingeschmolzen. Erst 2003 konnte auf Initiative eines Bürgervereins ein neues, dem alten Denkmal nachempfundenes Denkmal wieder eingeweiht werden.
Das Ende als selbstständige Gemeinde des Landkreises Niederbarnim der Provinz Brandenburg kam 1920, als durch die Verfassungsgebende Preußische Landesversammlung das Gesetz über die Bildung einer neuen Stadtgemeinde Berlin beschlossen wurde. Durch die Eingemeindung zahlreicher Gemeinden und Städte wurde Groß-Berlin gebildet.
Seither gehörte Friedrichshagen als Ortsteil zum Berliner Stadtbezirk Köpenick und seit der Verwaltungsreform von 2001 zum Stadtbezirk Treptow-Köpenick.
Auch nach dem 1. Weltkrieg entwickelte sich Friedrichshagen weiter und bleib beliebtes Ausflugsziel.
Ab 1922 produzierte Julius Fromm in seiner Friedrichshagener Fabrik in der Rahnsdorfer Straße die „Fromms“ genannten Verhütungsmittel für den Mann. Die Gummischutzfabrik wurde zu DDR-Zeiten abgerissen.
1927 wurde der Spreetunnel im Müggelpark eingeweiht und gleichzeitig der Fährbetrieb über die Spree eingestellt.
Den 2. Weltkrieg überstand der Ortsteil relativ unbeschadet. Natürlich gab es Kriegsschäden durch Luftangriffe und die Kämpfe während der Schlacht um Berlin im April 1945, aber großflächige Zerstörungen bleiben aus.
Zu den Kriegsopfern gehörte das auf dem (Köpenicker) Südufer gelegene große Ausflugsrestaurant „Müggelschlößchen“, das nach Bombentreffern ausbrannte und später abgerissen wurde.
Seit Beginn der 1960er wurden die Friedrichshagener Laubenkolonien aufgelöst und die Flächen für das Wohnungsbauprogramm der DDR genutzt. Gegenwärtig hat Friedrichshagen knapp 20.000 Einwohner.
Am Marktplatz wurde das Ortsbild durch ein vielgeschossiges Wohnhochhaus verschandelt, dem weitere folgen sollten. Wegen dem unsicheren Baugrund verwarf man diese Idee und baute stattdessen im Laufe der Jahre zahlreiche 3- bis 4geschossige Plattenbauten in den Wohngebieten Karl-Pokern-Straße, Karl-Frank-Straße, Emrichstraße, Albert-Schweitzer-Straße und Aßmannstraße.
Neben einem beliebten Ausflugsziel mit viel Wald und Wasser ist Friedrichshagen auch weiterhin begehrter Wohnort.
An die Gründerzeit als wohlhabende Gemeinde erinnern bis heute die zahlreichen Villen und mehrgeschossigen bürgerliche Wohnhäuser vor allem in der Bölschestraße, die mit ihren zahlreichen Geschäften auch die Haupteinkaufsmeile ist. In den Seitenstraßen gibt es dann meist die Wohngebiete.
Es gibt das Traditionskino „Union“, zahlreiche Gaststätten, viele Einzelhandelsgeschäfte und Supermärkte/Discounter, mehrere Schulen und Kindergärten, ein Seebad, einen großen Friedhof und 3 Kirchen (evangelisch, katholisch, Baptisten).
Vom Ur-Friedrichshagen hat sich nichts erhalten. Die wenigen eingeschossigen Siedlerhäuser stammen aus der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die anderen Bauten sind jüngeren Datums: 2. Hälfte 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, Anfang 21. Jahrhundert.
Nördlich und östlich grenzt Friedrichshagen an ausgedehnte Wälder. Den Süden dominiert der Große Müggelsee mit seinen Bade- und Wassersportmöglichkeit und ebenfalls großen Waldgebieten. Durch die Bebauung der Gründerzeit beschränkt sich der Zugang zum Müggelsee-Nordufer auf 3 Parks: den Müggelpark mit Spreetunnel und Dampferanlegestellen, den See-Park und einen kleinen öffentlichen Zugang gegenüber der Bruno-Wille-Straße.
Im östlichen Waldgebiet von Friedrichshagen hinter dem Wasserwerk gibt es die große Badestelle „Nordstrand“ (textil und FKK).
Seit ein Köpenicker Unternehmer in Friedrichshagen ein Wohnheim für Wohnungslose eröffnet und der Berliner Senat ab 2015 Unterkünfte für Flüchtlinge und Migranten eingericht hat, hat sich das Straßenbild im Ort nicht gerade zum besseren entwickelt.
An den ÖPNV ist Friedrichshagen durch die S-Bahn (S3) und die Straßenbahnlinien 60 und 61 angebunden. Außerdem gibt es mit der Linie 88 der Schöneicher-Rüdersdorfer-Straßenbahn noch eine Verbindung ins brandenburgische Umland.”
Weiterlesen
Text ausblenden
Bewvgeerfltuna1g myodelduzen